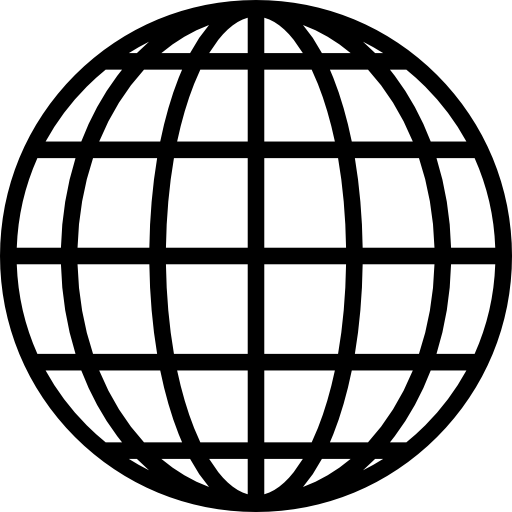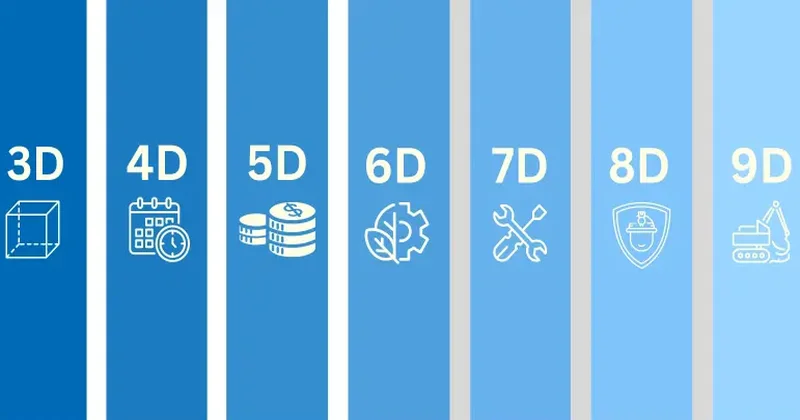15 Minuten Lesezeit
Mehr Nachhaltigkeit beim Planen und Bauen: praxisnah und prozessintegriert

Rund 38% des gesamten CO₂-Ausstoßes wird direkt durch den Bau von Gebäuden und Infrastruktur und deren Betrieb verursacht. Was CO₂ angeht, haben Bauherren und Bauindustrie einen enormen Hebel zur Reduzierung von Treibhausgasen in der Hand. Nachhaltigkeit bleibt auf der Agenda der Bau- und Immobilienwirtschaft und muss im Planungs- und Baualltag gängige Praxis werden.
Doch wie lassen sich Nachhaltigkeitsziele konkret in Bauprojekten umsetzen? Welche Rolle spielen digitale Werkzeuge dabei – und wie verändert sich der Vergabeprozess?
Gespräch mit Jürgen Demharter, Director Product Management and Research & Development RIB iTWO.
Herr Demharter, was gab Anlass, die Nachhaltigkeit jetzt in Ihre Software „einzubauen“?
Wir stehen in regem Austausch mit unseren Kunden. Und diese haben signalisiert, dass sie das Thema Nachhaltigkeit in Planung, Kostenermittlungen, Kalkulation und Auftragssteuerung berücksichtigen müssen. Ihre Anforderungen resultieren teilweise aus Gebäudezertifizierungen nach DGNB, ÖGNI, LEED u.a. oder der ESG-Berichterstattung (Environmental, Social, and Governance) von Auftraggebern, Bauunternehmen und Projektentwicklern.
Anforderungen für nachhaltigeres Bauen verpflichten doch auch den größten Auftraggeber, die öffentliche Hand?
Richtig – es gibt gesetzliche Anforderungen. Die öffentliche Hand löst rund ein Viertel der Bauinvestitionen in Deutschland aus (1). Laut Bundesverfassungsgericht (2) ist der Staat als öffentlicher Bauherr zum Klimaschutz verpflichtet. Das Bundesklimaschutzgesetz verlangt eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um 42% von 2022 bis 2030 und die einschlägigen Vergabenormen lassen die Wertung klimafreundlicher Bau- und Nutzungsweisen bei der Beschaffung ausdrücklich zu.
Traditionell fokussieren sich die Vergabeverfahren gewerblicher Bauherren und der öffentlichen Hand auf einen Preis-Leistungs-Wettbewerb. Künftig wird es auch verstärkt um einen Wettbewerb der nachhaltigsten und effizientesten Lösungen gehen. Alle Beteiligten, also Auftraggeber, Bauplaner wie auch Bauunternehmen werden in Zukunft neben dem Preis auch den CO₂-Fußabdruck und die Bauzeit in ihren Vergabeentscheidungen berücksichtigen müssen, wollen sie ihrer Verantwortung für nachhaltiges Bauen gerecht werden.
- HDB, Bauwirtschaft im Zahlenbild, 2022, S. 3
- BVerfG – Beschluss vom 24.03.2021
Wie können Ihre Kunden Nachhaltigkeitsanforderungen in ihrem Aufgabenbereich umsetzen?
Klimaschutz sehen wir als eine Gemeinschaftsaufgabe der Wertschöpfungskette Bau, die wir von der Planung bis zur Bewirtschaftung abdecken. Unsere Software hilft seit jeher dabei, die gängigen Parameter für ein erfolgreiches Bauprojekt neben Qualitäten und Quantitäten, Kosten, Termine und Projektrisiken zu managen. Als Lösungsanbieter für den Gesamtprozess Planen, Bauen und Betreiben war uns klar, dass wir die Bewertung der Nachhaltigkeitskriterien auch für jeden Akteur in diesem Prozess anbieten wollen. CO₂ und vergleichbare Nachhaltigkeitskriterien betrachten wir als einen weiteren Parameter, manche sprechen schon von einer sechsten Dimension, in der Planung und Bauausführung, die alle Baubeteiligten darin unterstützt, ihren Nachhaltigkeitsbeitrag im Projekt möglichst exakt ermitteln zu können.
Wie bemessen Sie Nachhaltigkeit eigentlich. Kann man über Ihre Software den Baumaterialien einen CO₂-Wert zuordnen?
Je nach Aufgabestellung können unterschiedliche Nachhaltigkeitskriterien im Fokus stehen: Dazu gehören die Verwendung von Recycling-Materialien, der Einsatz emissionsarmer Baustoffe oder die Verkürzung von Bauzeiten, die als Zuschlagskriterien zugrunde gelegt werden können. Entscheidend ist aber im Allgemeinen die Wertung des CO₂-Fußabdrucks eines Bauprojektes, der die Herstellungsphase der Baustoffe, die Bauwerkserstellung selbst, die Nutzungsphase wie auch den Rückbau oder Abbruch umfasst. Ein mittlerweile etablierter Ansatz besteht in der Einführung eines „CO₂-Schattenpreises“, der die Klimafolgekosten bzw. das Treibhauspotenzial eines Bauprojektes monetarisiert und einer vergleichenden Bewertung zugänglich macht.
Was bedeutet der Schattenpreis für CO₂?
Wir sehen es so: CO₂ ist der zentrale Schlüssel für klimaneutrales Bauen. Daher müssen wir versuchen, CO₂ auf jeder Wertschöpfungsstufe zu reduzieren. Das heißt: weniger „graues“ CO₂ in Baustoffen und Konstruktionen, mehr CO₂ sparende Logistik- und Bauprozesse und stärkere CO₂-Einsparungen im Betrieb und Rückbau.
Der Schattenpreis für CO₂ geht über eine rein ökologische Bewertung eines Bauvorhabens hinaus. Er versucht den CO₂-Fußabdruck aller Prozesse eines Bauprojekts monetär zu bewerten. Dies erlaubt allen Akteuren nicht nur die direkten Kosten eines Projekts zu berücksichtigen, sondern auch die indirekten Umweltauswirkungen in ihre Baukalkulation einzubeziehen. Und zwar ebenso transparent wie die direkten Kosten bei der Bauwerkserstellung.
Der CO₂-Schattenpreis ist ein rein monetäres Instrument, anders als etwa die Vorgabe fixer normativ-technischer Grenzwerte. Dieser Ansatz lädt dazu ein, effizientere und umweltfreundlichere Bauverfahren zu entwickeln, der sich in einem niedrigen CO₂-Schattenpreis niederschlägt und so die Gesamtkosten des Projektes reduzieren.
Wie wird dieser Wertungsansatz eines CO₂- Schattenpreis im Vergabeprozess umgesetzt?
Nachhaltige Gebäude entstehen nicht (nur) aus ökologischer und sozialer Verantwortung. Die Umweltauswirkungen einer Baumaßnahme zu bilanzieren, ist allerdings schon heute eine zentrale Maßnahme, um diese Gebäude z.B. nach DGNB, LEED oder BREEAM (1) zertifizieren zu lassen oder um hierfür Fördermaßnahmen in Anspruch nehmen zu können. Die Vermarktung bzw. der Werterhalt der Immobilien ist hier der Treiber für CO₂-Reduktion.
Für die öffentliche Hand, die rund 26% der Bauinvestitionen auslöst (2), bietet das Instrument des CO₂ Schattenpreises ein praktikables Instrument, um ihrer rechtlichen Pflicht zum Klimaschutz und ihrer Vorbildfunktion als Auftraggeber nachzukommen. Dies zeigt das Impulspapier „Klimaverträglich Bauen mit einem Schattenpreis für CO₂-Emissionen“ des Hauptverbandes der Bauindustrie in Zusammenarbeit mit KPMG (3) in einem sehr klaren Bild auf und hat auch die rechtliche Umsetzung im Rahmen des Vergabeverfahrens untersucht und bewertet.
- In Deutschland findet eine ganze Reihe an Zertifizierungssystemen Anwendung. Verbreitet sind die Systeme der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), das Label Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) sowie Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM). Je nach Bauaufgabe, Auftraggeber oder Region sind weitere Systeme verbreitet.
- HDB, Bauwirtschaft im Zahlenbild, 2022, S. 3
- 2023 / https://www.bauindustrie.de/themen/artikel/studie-klimavertraeglich-bauen (abgerufen 20.02.2025)
Klimaschutz verbindet Auftraggeber- und Auftragnehmerseite, wie sieht das konkret aus?
Die Autoren des Impulspapiers schlagen vor, als Zuschlagskriterium nicht wie bisher üblich, in erster Linie den Angebotspreis, sondern einen ganzheitlichen Wertungspreis zu verwenden. Dieser Wertungspreis besteht einfach ausgedrückt aus dem Angebotspreis (Bauleistung) und einem CO₂-Schattenpreis der die Klimafolgekosten (CO₂e-Emissionen als Treibhauspotenzial) in Euro pro Tonne CO₂-Äquivalent abbildet. Der CO₂e-Preis wird vom Auftraggeber im Vergabeverfahren einheitlich definiert und kann somit den Anspruch an nachhaltiges Bauen in Relation zum reinen Angebotspreis entsprechend priorisieren.

Unter CO₂-Schattenpreis wird ein fiktiver Preis entsprechend des vom Umweltbundesamt ermittelten Wertes für jede über den Bauwerks-Lebenszyklus entstehende Tonne CO₂ verstanden, der bei der Planung von Baumaßnahmen zu veranschlagen ist. Er liegt aktuell bei 237 € pro Tonne CO₂-Äquivalent (CO₂e).
Dieser Wertungspreis erlaubt dem Bauunternehmen durch innovative Material- oder Verfahrenswahl einen Bewertungsvorteil im Vergabeverfahren zu erzielen. Damit können über dieses Zuschlagskriterium auch die Klimafolgekosten, ermittelt über das Produkt aus Treibhauspotenzial in kg CO₂e und einem angemessenen Preis je Tonne CO₂e, berücksichtigt werden. Dieses Modell ist transparent, vergaberechtlich zulässig und wird in anderen europäischen Staaten bereits angewendet.
Dieses Bewertungsmodell der Nachhaltigkeit betrifft alle Akteure im Vergabeprozess. Für uns als Lösungsanbieter bestätigt das einmal mehr, dass es einer Softwareunterstützung bedarf, die alle Rollen vom Auftraggeber über den Unternehmer bis zum Subunternehmer oder Lieferanten bedient. Und genau dort sehen wir uns mit unserem Produkt RIB iTWO an einer zentralen Schlüsselrolle – der große Anwendergruppen aus dem Bereich der privaten und öffentlichen Auftraggeber und Investoren, aber auch bauausführenden Unternehmen und Bauindustrie repräsentiert. Daher konnten wir einen durchgängigen Prozess implementieren, der unserer Innovationsrolle auch hier gerecht wird.Wie machen Sie Nachhaltigkeitsbewertung für Planende und Unternehmen praktikabel?
Veranschaulichen wir unsere Idee der einfachen und praxisgerechten Umsetzung an einem Beispiel: Kosten müssen Sie als Architekt*in zu Planungsbeginn abschätzen und im Projektverlauf bzw. am Ende genau beziffern. Für CO₂-Emissionen sollte das Gleiche gelten. Also übertragen wir einfach die von der Kostenermittlung bekannte Systematik auf die CO₂-Berechnung. Dies machen wir analog für die Berücksichtigung von CO₂-in der BIM-basierten Arbeitsweise oder in der Angebotskalkulation. So implementieren wir die Nachhaltigkeit im digitalen Projektlebenszyklus mit RIB iTWO als eine zusätzliche Steuerungsebene neben Terminen, Kosten und Qualitäten.
Das heißt, AVA, BIM und Kalkulation gehen jetzt auch nachhaltig?
Nachhaltigkeit im digitalen Projektlebenszyklus von RIB iTWO, das heißt konkret, dass wir eine Prozessunterstützung für alle Stationen im Planungs- und Vergabeprozess anbieten.
Beginnen wir mit der Kostenermittlung: Hier definieren Sie CO₂-Äquivalente auf Ebene von Objekt, Kostenelement und Rezeptur. So können Sie unterschiedliche Gebäudevarianten und ihre jeweiligen CO₂-Emissionen in frühen Phasen einander gegenüberstellen. In der Ausschreibung knüpfen Sie Zielgrößen der Nachhaltigkeit an Positionen Abschnitte Gewerke und fordern Bieter auf, das Treibhauspotenzial nach einem einheitlichen Berechnungsverfahren zu ermitteln und auszuweisen. Neben- oder Alternativangebote mit besonders nachhaltigen Verfahren können in der Gesamtwertung beurteilt werden. In der Kalkulation legen Sie Nachhaltigkeitswerte als Artikel, Kostenarten, Kalkulationsbausteine oder Ergebnisse der Nachunternehmerausschreibung an. So fließt in Ihrem Angebot der CO₂-Beitrag der Nachunternehmerleistungen mit ein.
In der Angebotsbewertung bieten wir dieselben differenzierten Funktionen wie sie beim Vergleich der Angebotspreise üblich sind. So können Sie im Preisspiegel die Wertungspreise, gebildet aus Angebotspreis und Nachhaltigkeitspreiszuschlag (z.B. CO₂-Schattenpreis) genau bewerten.
Und entscheidend ist hier, dass sie in RIB iTWO nicht nur die reine Baukonstruktion bzgl. der Nachhaltigkeit betrachten, sondern auch die baubetrieblichen Prozesse (wie Bauverfahren, Geräteeinsatz und Logistik) mit in den Mittelpunkt der Bewertung stellen.
Wie stellen Sie Durchgängigkeit im Vergabeprozess her?
Mir war es von Anfang an ein wichtigen Punkt, für den Vergabeprozess eine entsprechende Interoperabilität sicherzustellen, mit der alle Baubeteiligten einen reibungslosen Datenaustausch über Systemgrenzen hinweg zu ermöglichen. Zusammen mit dem Bundesverband Software und Digitalisierung im Bauwesen (BVBS) haben wir an einem produktübergreifenden Datenaustausch zu Inhalten mit Nachhaltigkeitsbezug gearbeitet. Nach aktuellem Stand sind wir zuversichtlich dies dann im Datenaustausch über GAEB-DA-XML der Version 3.4 umsetzen zu können.
Bis dahin profitieren unsere RIB iTWO Kunden von einem vollumfänglichen Datenaustausch über die proprietäre RIB-XML Schnittstelle der Formate RIBX83 und RIBX84.
Jede Planung braucht Daten – CO₂ oder alternative Kennwerte – wo kommen die her?
Die vielfältigen Anforderungen der Auftraggeber unserer Kunden haben gezeigt, dass neben CO₂-Emissionen auch viele weitere Zielgrößen von Relevanz sein können. Daher haben wir die Berechnungssystematik ganz offen gestaltet, um beliebige Nachhaltigkeitskennwerte wie beispielsweise Feinstaubbelastungen, Dieselverbrauch von Baugeräten oder Lärmemissionen berücksichtigen zu können. So können Sie in RIB iTWO beliebig viele Datenkataloge mit unterschiedlichen Nachhaltigkeitskennwerte heranziehen. Diese Daten können beispielhaft von standardisierten Umweltproduktdeklarationen (EPD), deren Zahl mit zunehmender Aktualität des Themas rasant zugenommen hat, geliefert werden.
Dazu gehören vor allem die Ökobaudat, die als Plattform des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen eine umfangreiche Datenbasis bereitstellt. Diese und viele weitere Datenbanken (z.B. die österreichische baubook) liefern validierte Baustoffdaten für die Nachhaltigkeitsbewertung und erleichtern so die Nachweisführung im Rahmen von „grünen“ Ausschreibungen, Gebäudezertifizierungen und Förderanträgen.
Wie profitieren Ihre Kunden vom neuen Nachhaltigkeitsmodul (in RIB iTWO)?
Entscheidend ist hier, dass sie in RIB iTWO nicht nur die reine Baukonstruktion bzgl. der Nachhaltigkeit betrachten können, sondern auch die baubetrieblichen Prozesse (wie Bauverfahren, Geräteeinsatz und Logistik) mit in den Mittelpunkt einer gesamtheitlichen Nachhaltigkeitsbetrachtung stellen. Damit unterstützt RIB iTWO von der Bauplanung bis zum Abschluss eines Bauvorhabens fortlaufend in den Bewertungen und liefert die Datenbasis für die weiteren Schritte der Umsetzung. Wir liefern hier die Daten für die Berechnung grauer CO₂-Emissionen im Neubau, Werte für die Sanierung und CO₂-Reduktion von Bestandportfolios. Diese können Grundlagen für die Gebäudezertifizierung nach DGNB, ÖGNI, LEED u.a. sein. Darüber hinaus bieten wir ein projektübergreifendes Reporting im Nachhaltigkeitsmodul: Sie ermöglicht eine ganzheitliche Sicht auf die ökologischen Folgewirkungen eines Immobilienportfolios, was eine Grundlage für eine ESG-Berichterstattung (Environmental, Social and Governance) von Bauunternehmen und Projektentwicklern sein kann.
Das fundierte Ermitteln und Bereitstellen von Nachhaltigkeitswerten entlang unserer Kernprozesse, aufbereitet in einer Vielzahl von 3D-Visualisierungs- und Auswertungsmöglichkeiten, sowohl projekt- als auch projektübergreifend, bildet die Basis für eine Entscheidungsfindung entlang der Wertschöpfungskette des nachhaltigen Bauens. RIB möchte Bauunternehmen mit dem RIB iTWO Nachhaltigkeitsmodul eine integrierte Prozessplattform zur Verfügung stellen, die sie dabei unterstützt, den CO₂-Fußabdruck ihrer Projekte detailliert und baubegleitend zu ermitteln.
Haben Sie schon erste Kundenfeedbacks und was wünschen Sie sich für die Zukunft – evtl. auch adressiert an politische Entscheidungsträger?
Am 14. Januar 2025 haben wir auf der BAU 2025 in München das Release von RIB iTWO 2025 für unsere Kunden freigegeben. Seitdem haben wir durchweg positives Feedback erhalten. Unsere Kunden schätzen die Lösung als umfassend, hoch flexibel und konzeptionell gut durchdacht und sind hochmotiviert, RIB iTWO 2025 in ihren ersten Praxisprojekten anzuwenden.
Besonders die öffentliche Hand sehen wir in der Verpflichtung, den innovativen Ansatz des CO₂-Schattenpreises in zukünftigen Ausschreibungs- und Vergabeverfahren fest zu verankern. So kann nachhaltiges Bauen auch in der Praxis umgesetzt werden.
Herr Demharter, vielen Dank für das Gespräch!
Möchten Sie mehr über RIB iTWO erfahren, kontaktieren Sie uns jetzt. Gerne demonstrieren wir Ihnen in einer persönlichen Produktdemo die Vorteile unserer Software!
Sichern Sie sich hier Ihre kostenlose Produktdemo
Aktuelle Beiträge
15 Minuten Lesezeit
16 Minuten Lesezeit
13 Minuten Lesezeit
15 Minuten Lesezeit

Ebook